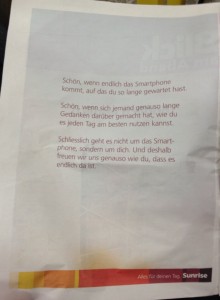Am 22. September 2011 erschien dieses Interview mit mir in der Sonderbeilage Mobilkommunikation der Neuen Zürcher Zeitung.
«Die Zeitung neuen Lesegewohnheiten anpassen»
NZZ-Digital-Chef Peter Hogenkamp zur Zukunft des Medienkonsums
Peter Hogenkamp, bei der NZZ für digitale Inhalte zuständig, befasst sich seit Jahren mit Online-Geschäftsmodellen. Im Gespräch äussert er sich zur Zukunft gedruckter Zeitungen und zur Herausforderung der Digitalisierung von Medieninhalten.
Interview: Walter Hagenbüchle
Peter Hogenkamp, blicken wir Jahre zurück. Welche Ideen gab es damals für eine Digitalisierung von Informationsinhalten? Gab es Konzepte für einen Transfer der Zeitung aufs Mobiltelefon?
Nur sehr rudimentär, etwa mit stark überteuerten SMS-Abos, an denen aber die Telekommunikationsfirmen mehr verdienten als die Inhaltelieferanten.
Von welcher Zeitrechnung sprechen Sie?
Die Mobiltelefonie im heutigen Format gibt es seit fünfzehn Jahren, die Produktkategorie «Smartphone» immerhin seit rund zehn Jahren, aber das Handling war doch sehr mühsam. Noch zu Zeiten meines Nokia E61, also bis 2006, kannte ich nur einige wenige Leute, die sich zusätzliche Software zum Zeitungslesen auf ihrem Handy installiert hatten. Dann aber kam das iPhone, kurz danach der App-Store – und plötzlich zeigten sich 60-jährige Banker beim Lunch gegenseitig ihre neusten digitalen Errungenschaften.
Das Rennen bei den Businessmodellen auf dem Handy gemacht haben also anfangs ganz andere Geschäftsinhalte. Zeitung auf dem Handy, das war doch eher eine «mission impossible», allein schon wegen des Formfaktors?
Die Zeitung, wie wir sie auf Papier kennen, 1:1 auf dem Handy abzubilden, war schwierig, ist schwierig und wird es immer bleiben. Der Smartphone-Bildschirm bedeckt nur rund einen Sechzigstel einer Broadsheet-Zeitungsseite. Um eine Zeitung im Original-Layout komplett zu lesen, ist also 1800-mal Blättern und Zoomen notwendig.
«Es gibt in der NZZ-Zielgruppe Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte.»
Also doch eine «mission impossible»?
Es ist tatsächlich nur etwas für Hardcore-Fans. Es kommt indes immer darauf an, welche Quellen man gerade zur Verfügung hat. Ich habe in den Ferien am Strand schon komplette «Spiegel»-Ausgaben auf dem iPhone gelesen, um teures Roaming zu vermeiden.
Weiten wir also den Blick vom winzigen 3-Zoll-Screen eines Smartphones hin zur digitalen Revolution des 10-Zoll-iPad. Dieser Quantensprung gilt ja als Initialzündung für den Transfer der Zeitung auf den digitalen Kanal. Haben sich die Erwartungen der Verleger erfüllt?
Ich fand es immer etwas blauäugig, als einige letztes Jahr dachten, nur weil wir jetzt einen grösseren Bildschirm und einen etablierten Zahlungsprozess hätten, werde automatisch alles gut. Die ersten euphorischen Meldungen einiger Verleger waren wohl etwas voreilig. Unsere Erfahrungen als NZZ mit dem iPad sind aber sehr positiv: Mit rund 6000 bezahlten Downloads unseres E-Papers pro Tag nehmen wir den Spitzenplatz in der Schweiz ein. Zugegeben: noch eine kleine Zahl verglichen mit der gedruckten Auflage, aber stetig wachsend.
Von einem künftigen Alternativmodell zur Zeitung, also einem rentabel mit Online-Werbung finanzierten Medienauftritt im Netz, ist man also weit entfernt. Oder anders gesagt: Die prognostizierte Goldader für die Verleger konnte bisher nicht freigelegt werden.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass – vielleicht abgesehen von der kurzen Euphorie der «internet bubble» von 1999 – jemand behauptet hätte, werbefinanzierte Online-Nachrichten seien eine Goldader. Aber es gibt natürlich inzwischen zahlreiche Beispiele, die sehr profitabel sind.
Können Sie solche nennen?
In den USA haben in den letzten Jahren werbefinanzierte Inhaltsanbieter bei Verkäufen mehrstellige Millionenbeträge erlöst, wie etwa die «Huffington Post» beim Verkauf an AOL. Aber auch im deutschsprachigen Raum macht etwa das international bekannteste deutsche Nachrichtenangebot «Spiegel Online» schöne Gewinne, wie man hört. Das über Jahrzehnte sehr profitable Zeitungsgeschäft mit Oligopolen oder gar regionalen Monopolen hat halt alle verwöhnt, da hat es jedes andere Modell schwer.
Welches sind denn, ausgehend von dieser unternehmerischen Challenge, die anderen grossen Knacknüsse im Businessmodell bei der Übertragung von Zeitungsinhalten auf digitale Kanäle?
Die grösste Knacknuss ist, das Angebot dem Leseverhalten anzupassen. Früher las man die Zeitung beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit – und dann war’s das in der Regel mit dem Nachrichtenkonsum bis zur «Tagesschau» am Abend. Heute wissen wir, dass viele Leute das Smartphone als Wecker nutzen und entsprechend im Bett das erste Mal die Nachrichten der Nacht anschauen. Dann auf dem Arbeitsweg und immer wieder zwischendurch am Arbeitsplatz. Die Mittagspause war ein Online-Jahrzehnt lang eine «Peakzeit», verliert aber nun diese Stellung, denn durch die mobilen Geräte haben die Menschen das Internet immer bei sich, einfach auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Bildschirmgrössen.
Das heisst also, dass für jede Bildschirmgrösse unterschiedliche Auftritte programmiert werden müssen, die vom PDF über die App bis hin zum interaktiven Zeitungsmodell reichen? Entstehen da also völlig unterschiedliche Auftritte unter demselben Brand? Oder anders gefragt: Müssen sich die Zeitungsinhalte der Technik unterordnen?
Das ist eine gute Frage, die bis jetzt noch nicht definitiv beantwortet ist. Der Erfolg unseres E-Paper-Angebots auf dem iPad zeigt einerseits, dass viele Leserinnen und Leser heute noch die Zeitung als Bündelungsform wünschen. Das Format ist ihnen vertraut, sie bevorzugen es aber ortslos bzw. je nach Gelegenheit manchmal auf Papier, manchmal elektronisch. Aber das dürfte für viele Nutzer letztlich nur ein Zwischenschritt sein. Denn je länger der Tag fortschreitet, desto weniger will man den Stand des Vorabends lesen.
Wie also sähe dieser Kompromiss aus verlegerischer Optik aus?
Die Zukunft könnte eine Art Live-Paper auf dem mobilen Endgerät sein: Zeitungsqualität, rund um die Uhr aktualisiert. Ob die Inhalte dabei je nach Bildschirmgrösse variieren sollen oder ob gilt: «Ein Angebot auf allen Plattformen», wird sich zeigen. Unsere Arbeitshypothese derzeit ist Letzteres.
Analysieren wir diese Inhalte näher. Ketzerische Stimmen monieren ja, Online-Inhalte seien weniger tiefschürfend recherchiert und könnten daher eine Marke qualitativ unterwandern. Wie kontern Sie den Vorwurf?
Wieso Vorwurf? Das ist eine Tatsache. Wo Online- und Print-Redaktionen getrennt arbeiten – also in den meisten Verlagen –, sind Online-Ableger meist nur mit einem Bruchteil der Ressourcen dotiert. Wie wollen Sie mit einem Zehntel der Leute rund um die Uhr ein Angebot erbringen, das mit einer sechs Mal die Woche erscheinenden Zeitung mithalten kann? Die bis heute noch geltende Aufteilung Print/Online war ein Konzept für das erste Online-Jahrzehnt. Es wird nun aber reihum den neuen Nutzungsgewohnheiten angepasst.
Trotzdem nachgehakt: Also doch die Gefahr eines qualitativen Bruches zwischen den beiden Inhalten?
In der Tat kann sich ein schlechter Online-Auftritt auf die Wahrnehmung der gesamten Marke auswirken. In Deutschland gibt es gut sichtbare Beispiele dafür. NZZ-Online aber hat immer seriösen News-Journalismus erbracht, daher sehe ich bei uns bis jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Marke, vor allem da wir künftig auch personell aufstocken können.
Ich resümiere also: Der vielzitierte Qualitätsjournalismus ist auch beim Online-Auftritt die entscheidende Leitplanke. Eine NZZ kommt folglich auch auf digitalen Kanälen, was die Relevanz der Themen betrifft, künftig nie wie eine Gratiszeitung daher?
Eine Zeitlang war man der Meinung, die Leute wollten im Netz nur Anspruchsloses lesen, aber das ist inzwischen klar widerlegt. Die deutsche «Zeit» unterstreicht das eindrücklich mit ihrem Angebot «Zeit Online», das sehr seriös daherkommt, aber selbstverständlich anders als die Wochenzeitung. Auch die NZZ muss auf jedem Kanal ihr Markenversprechen einlösen, seriös und kompetent zu informieren, wobei es durchaus kanalspezifische Eigenheiten geben kann.
Dann stellen Sie konsequenterweise an einen Online-Redaktor auch die gleichen Anforderungen wie an jenen, der für die gedruckte Zeitung arbeitet?
Man muss jedes Angebot refinanzieren können. Online ist als Medium noch gar nicht so alt, wie viele Print-Journalisten schon bei einer Zeitung arbeiten. Das ist wohl auch der naheliegendste Grund für allfällige Einkommensunterschiede. Wenn aber elektronische Medien dann so ertragreich arbeiten wie Zeitungen, wüsste ich nicht, wieso man die Journalisten schlechter bezahlen sollte.
Dieses Argument müsste ja dann wohl auch umgekehrt gelten?
Ja. Wenn Zeitungen einmal weniger Geld verdienen, wird man auch Print-Journalisten weniger bezahlen können – oder weniger von ihnen beschäftigen, was vielerorts schon geschehen ist. Viele Journalisten aller Sparten könnten bekanntlich in anderen Branchen, etwa im PR-Bereich, mehr verdienen; es ist nie verkehrt, wenn man seinen Beruf vor allem als Herzensangelegenheit sieht.
Wenn es ums Geld geht, dann muss auch von einem zweiten Pièce de Résistance beim digitalen Medienkonsum gesprochen werden: von der Paywall, hinter der Lesen etwas kostet. Glauben Sie, dass die an Gratiskultur im Netz und beim News-Konsum gewöhnten Nutzer sich auf Bezahlmodelle umerziehen lassen?
Diese berüchtigte «Gratiskultur im Internet» ist doch vor allem ein Schlagwort. Ich gebe fast jeden Tag Geld im Internet aus. Für Software, für Services, für Musik, für Filme und so weiter. Zugegeben, für aktuelle Nachrichten in der Regel nicht. Deswegen können wir auch das heutige NZZ-Online nicht kostenpflichtig machen.
Sie meinen, dass für reine Online-News nie bezahlt werden wird?
Ja, aber die «Neue Zürcher Zeitung» und die «NZZ am Sonntag» bieten ja eben deutlich mehr als nur News. Ich bin daher überzeugt, dass es in unserer Zielgruppe eine Zahlungsbereitschaft geben wird. Allerdings wird man dann strenggenommen wohl weniger für Inhalte zahlen als für eine Dienstleistung. Ein Student zum Beispiel kann es sich leisten, eine halbe Stunde zu suchen, bis er etwas gratis findet. Ein Berufstätiger zahlt dagegen hoffentlich lieber weiter sein Abo, damit die NZZ-Redaktion ihm diese Arbeit abnimmt.
Wie sieht denn nach Ihrer Prognose der künftige Zeitungsalltag aus? Gibt es ein friedliches Nebeneinander von Print und Online? Oder müssen wir gar davon ausgehen, dass die gedruckte Zeitung mittelfristig ausstirbt?
Das weiss niemand. Ich vermute, dass es die Tageszeitung auf Dauer schwer haben wird, weil der Prozess der nächtlichen Produktion und Distribution aufwendig und teuer ist. Und je mehr Leute ins Digitale abwandern, desto mehr müssen die verbleibenden Zeitungsleser zahlen. Aber wie gesagt, ich lasse mich zu keinen Prognosen hinreissen. Und es muss für einen Verlag auch egal sein: Wir sind schlicht und einfach verpflichtet, innovative Vertriebs- und Geschäftsmodelle aufzubauen, die es uns ermöglichen, auch ein Szenario ohne gedruckte Zeitung zu bewältigen. Dann können wir der Entwicklung gelassen entgegensehen.
Lassen sich denn die Rückgänge bei der Print-Leserschaft überhaupt durch den Einsatz mobiler Devices als alternative Plattformen substituieren?
Natürlich, denn die Menschen werden sich ja weiter darüber informieren wollen, was in der Welt passiert. Und sie werden, soweit wir das heute beurteilen können, auch weiter Selektion und Einordnung wünschen. Ich bin sogar überzeugt, dass wir in Zukunft viel mehr Kontakte zu unseren Leserinnen und Lesern haben werden, weil der Nachrichtenkonsum sich über den ganzen Tag verteilt.
Noch eine Frage zum Businessmodell nachgereicht. Bekanntlich erodieren die Inserateeinnahmen im traditionellen Zeitungsgeschäft stark. Rechnen Sie damit, dass sich der Rückgang angesichts weit tieferer Tarife bei der Online-Werbung überhaupt jemals auffangen lässt?
Wie gesagt, die Verlage waren lange in einer äusserst glücklichen Situation mit sehr guten und stabilen Renditen. Sie fragen mich, ob ich glaube, dass sich dieser Zustand in der digitalen Welt wieder einstellt? Nein. Und glaube ich, dass man mit Nachrichten weiterhin Geld verdienen kann? Ja. Es wird nur alles sehr viel komplizierter, und alle in der Branche sind noch am Üben.
Die traditionelle Zeitung lebt ja vom Stammleser. Kann denn digital überhaupt eine solche Identität hergestellt werden, die all jene Vorzüge der Markentreue umfasst, wie wir sie kennen? Oder anders gefragt: Wird es angesichts der flüchtigen Rezeption auf den elektronischen Kanälen in einer Vielzahl von Communitys überhaupt künftig noch so etwas wie die traditionellen Stammleser einer Zeitung geben?
Auch das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Netz wird es beides geben: die als «long tail» bekannte Fragmentierung, aber auch weiterhin die quasi natürliche Tendenz zum Massenmedium. Die Menschen sind gesellig und versammeln sich gern mit vielen anderen an einem Ort, auch an einem virtuellen. Die Zugehörigkeit von Stammlesern zu einem digitalen Medienangebot kann wegen der vielen Interaktionsmöglichkeiten sogar enger sein als bei der herkömmlichen Zeitung. Allerdings braucht es dazu auch interagierende Journalisten.